Rezension: Martin Korte / Wir sind Gedächtnis
Der Neurobiologe Martin Korte sieht das Gedächtnis als Kern des menschlichen Lebens an. Er schreibt, dass wir ohne dieses nicht wir wären. Erinnerungen würden demnach bestimmen, “[…] wer und was wir sind, und auch was wir mit anderen teilen.“ Ohne unser Gedächtnis könnten wir nicht verstehen, was eine menschliche Persönlichkeit auszeichnet. Das Gehirn sei dem Autoren zufolge kein statisches Organ, da sich das neuronale Substrat durch Gedächtnisprozesse ständig verändere.
Inhaltsverzeichnis
Gene oder Erfahrung?
Die Frage, ob unsere Gene uns determinieren oder die Lebenserfahrung, hält Korte für geklärt. Dem Neurobiologen nach zeige die Forschung der letzten Jahre, dass wir viel stärker durch Erlebtes, Erlerntes und Abgespeichertes geprägt werden als durch genetische Faktoren.

Das Gedächtnis gibt einen Schlüssel zum Wesen des Menschen, dieser uralten Frage der Philosophie, meint Korte und schreibt: „Wer aber die Frage „Was ist der Mensch“ (Ecce homo?) beantworten will, der muss unsere Gedächtnisfähigkeit verstehen, denn es ist das Gedächtnis, welches die Biologie mit der Kultur verknüpft, (…) nature (Natur) mit nurture (Erfahrungen) verkittet.“ Dies unterscheide, so zitiert er den Anthropologen David Bidney, den Menschen von anderen Tieren, deren Entwicklung vor allem durch ihre biologische Anlage konditioniert sei, während der Mensch das größte Spektrum an Fähigkeiten habe, weil er sich selbst forme.
Das autobiographische Gedächtnis
Ein autobiographisches Gedächtnis sind die Erinnerungen und Erfahrungen, die ein menschliches Individuum in seinem eigenen Leben gewinnt. Dieses steht aber nicht allein, sondern ist an soziale Beziehungen gebunden – das autobiografische Gedächtnis ist ein soziales Gedächtnis: „Das Gedächtnis ist für uns individuell von essentieller Wichtigkeit, aber es manifestiert sich erst im sozialen Kontext: Es ist Voraussetzung und Mittel zur Kommunikation – mit uns selbst, mit anderen und über die Zeiten hinweg als Kultur.“
Das autobiographische gehört, so Korte, zum Langzeitgedächtnis. Hier speichern wir Episoden unseres Lebens in Ich-Perspektive auf. Auch das Quellengedächtnis, also die Erinnerung an den Ursprung einer Erinnerung, fällt unter autobiografisches Gedächtnis.
Der Hippocampus bildet noch bis zum sechsten Lebensjahr Nervenzellen – bis seine Fornixbahn vollständig funktioniert. Dies sei wahrscheinlich notwendig, um individuelle Erlebnisse zeitlich markieren zu können. Dabei reihe unser Leben ständig Lernsituationen aneinander, bei denen alle Gedächtnissysteme ineinandergriffen.
Lernen, Gedächtnis und Gefühle hängen hirnanatomisch ganz eng miteinander zusammen, so Korte, und dies erkläre, warum eine Gefühlslage, die der Stimmung zur Zeit der Erinnerung entspräche, das Abrufen dieser Erinnerung erleichtere. Er spekuliert, ob die „Zeitmaschine in unserem Kopf“ die Evolution des Menschen maßgeblich beschleunigte, und ob der Neandertaler womöglich Wissen nicht in gleicher Form weitergeben konnte.
Dabei funktioniere die Zeitreise aus der Ich-Perspektive sowohl in die Vergangenheit wie auch in die Zukunft. Gedächtnisvorgänge hätten also nicht nur die Funktion, uns an unsere Kindheitstage zu erinnern, sondern auch, die Zukunft aufgrund unserer Erfahrungen vorherzusagen.
So seien die gleichen Strukturen im Gehirn aktiv, wenn wir die Vergangenheit Revue passieren ließen wie wenn wir die Zukunft planten. Der mediale Schläfenlappen werde ebenso aktiviert wie der mediale Anteil des präfrontalen Cortex und des Hippocampus.
Erinnern heißt rekonstruieren
Der Hippocampus würde Ereignisse mit Hilfe seines räumlichen Gedächtnisses miteinander in Beziehung setzen. Erst durch dieses Raum-Zeit-Kontinuum im Hippocampus könnten wir Ereignisse unseres Lebens in der richtigen Reihenfolge erinnern. Im Hippocampus könnten sich Raum und Zeit sortieren. Erst durch dieses Protokoll der zeitlichen Eckpunkte unseres Lebens könnten wir autobiografische Erinnerungen rekonstruieren.
„Erinnern ist nicht das Abrufen von gespeicherten, fertigen Bildern (Vorstellungen), sondern ähnelt dem Re-konstruieren eines Urmenschen aus den Überresten der Knochen, die man bei Ausgrabungen gefunden hat,“ so Korte.

Solche Re-Konstruktionen seien abhängig von den Umständen, den Emotionen während des Erinnerns und Ereignissen, die die Persönlichkeit prägten. Der Erinnerungsprozess selbst greife beim autobiographischen Erinnern selbst in die abgespeicherten Erinnerungen ein und passe diese an. Beim Erinnern veränderten wir also die Erinnerungen. Dadurch lieferten die Erinnerungen immer einen Bezug zum gegenwärtigen Geschehen und Fakten wie Erlebnisse ließen sich über Assoziationen ins Gedächtnis rufen.
Zeit bedeutet Ich
Wir können, so der Neurobiologe, ein autobiographisches Ich nur entwickeln, indem wir die Elemente unserer Erinnerungen in eine zeitliche Beziehung setzen. Das Gedächtnis diene dabei vermutlich dazu, die Zukunft zu planen, indem wir uns die abgespeicherten Informationen vergegenwärtigen, wir würden vergangene Ereignisse durch nachfolgende modifizieren und unsere autobiografischen Erinnerungen immer wieder abwandeln. Diese autobiografischen Erinnerungen seien das, was wir unser Leben nennen.
Frühe Gedächtnislücken
Die frühe Kindheit liegt in der Erinnerung von Erwachsenen weitgehend im Dunkel. Meist erinnern wir uns erst an Dinge, die nach unserem dritten Lebensjahr stattgefunden haben, erläutert der Autor. Immer häufiger erinnerten wir uns dann an Geschehnisse nach unserem sechsten Geburtstag. Dieses Phänomen heißt „kindliche Amnesie“, so Korte.
Die Neurobiologie widerspreche heute Freud, der diesen Umstand auf das Verdrängen zurückführte. Es zeige sich aber, dass wir unsere Erinnerungen an die frühe Zeit nicht verdrängen, sondern sie als Kleinkinder noch nicht entwickelt hätten. So seien vor dem dritten Lebensjahr die Hirnregionen zum Abspeichern autobiografischer Erinnerungen noch nicht voll in die Schaltkreise des Gehirns integriert, vor allem nicht in den Hippocampus und seine Informationsleitung.
Neugeborene könnten zwar bereits Informationen über eigene Erfahrungen speichern und Wichtiges von Unwichtigem trennen. So würden frühkindliche Erfahrungen als unbewusste Erinnerungen abgespeichert. Wir hätten darauf aber keinen bewussten, sprachbezogenen Zugriff.
Die Sprachentwicklung entscheide mit, wie schnell Kinder ein autobiografisches Gedächtnis entwickelten: „Je mehr Eltern sich mit ihrem Nachwuchs über Erlebnisse austauschen, umso schneller entwickeln Kinder ein autobiographisches Gedächtnis.“
Menschen entwickelten einen Teil ihrer Identität erst, wenn sie auch tatsächlich über ihre Lebensereignisse berichteten – mittels der Sprache. Das sei mit dem Alter von sechs Jahren der Fall. Mit circa 16 fingen wir dann an, verschiedene Erlebnisse des Lebens zu verknüpfen und zu bewerten, mit circa 20 begännen wir, unsere Entwicklung zu reflektieren. Besonders prägten uns dabei Erlebnisse zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr. In dieser Phase würden wir zugleich Ereignisse das erste Mal durchleben und zweitens speicherten wir jetzt besonders gut Neues ab. Das Gedächtnis sei der entscheidende Faktor intellektueller Reifung.
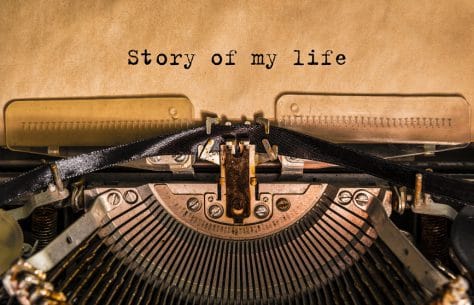
Der Ich-Erzähler
Der Sprung zwischen episodischem Gedächtnis und Ich-Erfahrung läuft, dem Autor nach, über das Gefühl. Erst wenn sich ein erinnertes Erlebnis als eigenes anfühlt, wird es zu „unserer“ Erinnerung.
Wir würden uns automatisch häufig irren, weil eine Menge parallele Prozesse im Gehirn abliefen, die Erinnerungen verfälschen könnten. Real erinnerte und falsch erinnerte Objekte würden das Gehirn fast identisch aktivieren.
Das Schaffen von Erinnerungen
Laut Korte erinnern wir uns sogar an Geschichten, die uns jemand als Kind erzählte und verwandeln diese in unsere eigenen. Jedes Mal, wenn wir uns an etwas erinnern, so der Experte, legen wir uns über eine alte neuronale Spur eine neue an. Wenn wir uns erinnern, dann aktivieren wir in Wirklichkeit immer nur die jüngste Spur, und die Vorstellung, „wir würden in der Zeit zurückreisen, scheint falsch zu sein.“
Erinnerungsspuren würden von Kopien überschrieben, die durch das Wiedererzählen und Wiederleben dieser Erinnerungen entstünden. Das Älteste werde kurzfristig zum Neuesten, das Erste zum Letzten, zitiert Korte den Gedächtnisforscher Douwe Draaisma.
Die Stärke und Schwäche unseres Gedächtnisses zugleich bestehe darin, dass unsere Erinnerungen immer eine Rekonstruktion von Erlebtem anhand weniger Eckpunkte seien. Deshalb sei es effektiv, aber zugleich vergesslich und fehlbar.
Dies belegte auch eine Studie der Psychologin Elisabeth Loftus und zwar anhand von jungen Psychologen, die sich also erstens hauptberuflich mit false memories beschäftigten und zweitens in einem besonders aufnahmefähigen Alter befanden. Nur zwei Wochen nach einer Konferenz hatten die Teilnehmenden 92 % der Inhalte dieser Konferenz vergessen. Selbst die übrigen 8 % bestanden zur Hälfte aus falschen Erinnerungen, also aus falschen Rekonstruktionen.
Das Gedächtnis könne, so der Autor, zu keinem Zeitpunkt unseres Lebens präzise, unfehlbar und vollständig Informationen abspeichern. Mehr noch: Es versuche überhaupt nicht, ein akkurates Bild der Vergangenheit zu erstellen. Das ist, laut Korte, nicht die Aufgabe des Erinnerns, sondern wir speicherten die Gefühle und Bedeutungen, die wir einer Situation zumessen, und diese Erinnerungen würden sich beim erneuten Abspeichern verändern, so dass wir ständig am Skript unseres eigenen Lebens arbeiteten.
Zwar würde unser Gedächtnis nur selten Geschehnisse frei erfinden, doch unsere Erinnerungen seien leicht suggestiv zu beeinflussen. Dies habe fatale Auswirkungen vor Gericht, wo Falschaussagen für die Zeugen selbst umso glaubhafter würden, je öfter sie diese wiederholten.
Gegenwart oder Vergangenheit?
Alte Erinnerungen prägten das, was wir in der Gegenwart erlebten und später erinnerten. Unser Gehirn würde Eckpunkte eines Erlebnisses speichern und anhand von Wahrscheinlichkeiten zu Erlebnissen zusammensetzen – anhand von kleinsten Bruchstücken. Als Datenspeicher wäre das sehr effizient, aber auch anfällig für Fehler.
Das „Erlebnis“ forme sich im Moment des Erinnerns. Diese Rekonstruktion hätte keine direkte Linie zum ursprünglichen Erlebnis und sei für Verzerrungen empfänglich. Die Verzerrungen könnten dem Buch zufolge dadurch entstehen, dass verschiedene Gehirnbereiche die Erinnerung an ein konkretes Ergebnis formen.
Diese Bereiche arbeiteten zwar Hand in Hand, aber zugleich unabhängig voneinander: Bestimmte Areale bewahrten Bruchstücke von Bildern, Gerüchen oder Geschmäckern auf, andere könnten diese Sinneserfahrungen verbinden und wieder andere verknüpften sie mit Fakten- und Erfahrungswissen.
Die Stimmung schafft das Erlebnis
Es ist also falsch zu denken, wir würden schlummernde Erinnerungen wecken. In Wirklichkeit erschaffen wir die Erinnerung an das, was wir seit dem ersten Speichern erlebten. Die momentane Stimmungslage bestimme, wie wir frühere Erlebnisse erinnerten, wir speicherten diese Anpassung sogar mit ab und webten sie in das neuronale Netz der jeweiligen Erinnerung ein. Vorwissen bedeute dabei auch Vorurteile. +

Es gibt in unserer Wahrnehmung also nicht „die Welt an sich“. Korte schreibt: „Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, wir nehmen sie auch nicht wahr, wie sie scheint, wir erleben sie so, wie Verschaltungen in unserem Gehirn dies vorgeben – und diese Verschaltungen sind viel mehr von unserem Gedächtnis als von unseren Genen geprägt.“
Menschen würden demnach gemeinsame Erfahrungen unterschiedlich erinnern, weil sie danach unterschiedliche persönliche Erlebnisse hatten.
Wir sollten, laut Korte, skeptisch sein, wenn uns Erinnerungen zu real und richtig vorkämen. Der Mensch konstruiere sich zwar seine Gedächtniswelt, er konstruiere sie aber in etwas Gegebenes hinein. Es gibt also durchaus eine „Realität“, auf deren Basis das Gehirn Erinnerungen konstruiert.
Gewohnheit, Sucht, Routine
Bewusstes und Unbewusstes lassen sich, dem Autor zufolge, nicht isoliert betrachten. Die meisten Tätigkeiten verrichteten wir automatisch, zugleich seien sie ohne Gedächtnis unmöglich. Das meiste, was dieses leiste, sei uns nicht bewusst: Ohne nachzudenken, würden wir Beispiel ohne Probleme 150 Wörter pro Minute vorlesen.
Auch Gewohnheiten gehörten zu diesem impliziten Gedächtnis – wir würden sie oft nicht einmal bemerken. Ein Großteil unseres Tagesgeschehens würde aus diesen Gewohnheiten bestehen. Verhalten sei nur durch Absicht bestimmt, wenn es nicht automatisiert sei. Je häufiger wir Abläufe wiederholten, desto wichtiger werde der Kontext der Handlung und desto mehr rücke das Ziel in den Hintegrund.
Das gelte besonders für Süchte, in denen das ursprüngliche Motiv, Spaß an einer Sache zu haben, keine Rolle mehr spiele. Das bewusste Gedächtnis mache nur einen Bruchteil unserer Gedächtnisprozesse aus. Süchte seien Gewohnheiten, gegen die wir uns bewusst nur schwer oder überhaupt nicht wehren könnten.
Das motorische Gedächtnis sei in Handlungen eingebettet. Wenn wir Bewegungsabläufe übten, so Korte, würde das Gehirn anfangs die Ziele vorgeben. Später speicherten jedoch die Strukturen, um eine Handlung auszuführen, selbst die Information. Damit sei das Gelernte automatisch abrufbar und müsse nicht erst durch den bewussten Filter gehen.
Wiederkehr
Eine Situation könnten wir schneller einschätzen, wenn wir sie schon einmal erlebt hätten. Auch Objekte und Wörter könnten wir besser einordnen, wenn wir mit ihnen in Kontakt waren. Der Neurobiologe nennt als Beispiel Restaurants, Opern oder Theater, deren übliche Abläufe wir kennen. Hinweisreize würden uns assoziativ helfen, eine Situation zu beurteilen, Aufgaben schneller zu lösen und Gelerntes leichter abzurufen.
Zudem lernten wir mehr aus dem, was jemand uns vorlebt und was wir selbst erlebten als aus dem, was jemand uns erklärt. Gutes Benehmen lernten Kinder besser durch Vorleben als durch Ermahnung. Lernen durch Nachahmung sei bei Menschen besonders stark ausgeprägt, bedingt durch Spiegelneuronen in der Großhirnrinde. Diese Nervenzellen seien auch aktiv, wenn andere Menschen eine Bewegung ausführten. Je vertrauter jemand mit einem anderen Menschen sei, umso besser würden sie funktionieren. Neurone könnten schnell Muster ergänzen, wenn sie die Muster wiedererkennen. Auch Wahrnehmung folge so dem Gedächtnis.
Unsere sensorische Wahrnehmung sei somit stark veränderlich und keinesfalls evolutionär fixiert. Erfahrungen würden alle Informationsebenen des Gehirns verändern.
Wahrnehmungsgedächtnis
Wahrnehmung ist, laut dem Autor, eine Interpretation der Welt aufgrund von gespeicherten Vor-Erfahrungen. Dabei würde unser Gehirn über die Pubertät hinaus weiterwachsen, und die Synapsen spiegelten die individuellen Erfahrungen, die ein Mensch in seiner Umwelt mache. Eine zunächst unverständliche Abbildung bekomme durch Erfahrung in der Wahrnehmung Bedeutung. Wahrnehmung ist folglich eng an Erfahrung und diese an das Gedächtnis gebunden.
Wahrnehmungen seien also Hypothesen über die Welt auf der Basis von Vorerfahrungen. Der Vorteil ist, folgt man Korte, dass interne Prozesse im Gehirn dann keine äußeren Reize mehr bräuchten. Durch unsere Vorerwartungen könnten wir schneller Abläufe assoziieren, die zusammengehören.
Auch die Wahrnehmung des eigenen Körpers werde durch Gedächtnisprozesse geordnet. Dies zeige sich zum Beispiel an Phantomschmerzen. Hier erinnern wir uns an Schmerzen in einem Körperteil, der real nicht mehr existiert und fühlen „real“ einen Schmerz, den es an dieser Stelle fleischlich nicht geben kann.

Im Großhirn sei die gesamte Körperoberfläche wie auf einer Landkarte abgebildet, bei einer Amputation würden die entsprechenden Tastsinnesbereiche nicht stillgelegt, sondern benachbarte Areale nähmen sie jetzt ein.
Korte schreibt: „Berührt man bei einem solchen Patienten vorsichtig die Wange, so empfindet er oft gleichzeitig eine Berührung seines amputierten Arms.“ Wir benötigten keinen Körper, um einen zu fühlen.
Intuition – Das schnelle Gedächtnis
„Je mehr wir auf einem Gebiet wissen, umso differenzierter nehmen wir die Welt wahr, und gleichzeitig wird der Aufwand, den wir für diese differenzierte Weltsicht aufwenden müssen, geringer,“ so der Autor.
Das verrät einiges über das „Geheimnis“ der Intuition. Intuition meint, dem Neurobiologen nach, rasch zu einer Einsicht zu kommen, ohne die tieferen Gründe zu kennen und oft sogar danach zu handeln. Wir würden unbewusst vertraute Muster erkennen, die wir im impliziten Gedächtnis gespeichert hätten, mit anderen Worten: Je größer unser Vorwissen ist, desto besser funktioniert unsere Intuition.
Intuition geht also einher mit Erfahrung, sie ist eine Verdichtung früherer Erfahrungen und kristallisierter Gedächtnisvorgänge. Sie sind weder irrational noch spontan, sondern das Produkt analytischer Prozesse, deren Struktur extrem verdichtet ist.
Vorurteile
Dieses komprimierte Abrufen von Gedächtnisinhalten befähigt uns zwar zu schnellen Schüssen, birgt aber auch eine Gefahr in sich – die Vorurteile. Diese entwickeln wir nicht bewusst, sondern das Gehirn teilt die abgespeicherten Weltwahrnehmungen in Typen auf: Klischees und Stereotypen haben also nicht nur manche Menschen im Kopf, sondern alle.
Wir könnten aber unsere unbewussten Vourteile bewusst machen und gegen sie angehen. Er schreibt: „Wer dagegen nur Vorurteile anderer sieht, dem entgeht Wesentliches bei sich selbst.“ Vorurteile sind nicht nur für andere Menschen gefährlich, die deren Opfer werden, sondern auch für den Menschen, der das Vorurteil hat und/oder übernimmt.
Korte belegt dies an Versuchen, deren Ergebnis erschreckt: Der Kognitionspsychologe Claude Steele von der Stanford University führte einen Test durch, in dem Studentinnen gesagt wurde, Frauen seien mathematisch weniger begabt als Männer. In der Folge schnitten die Teilnehmerinnen schlechter in den Tests ab als ohne dieses Vorurteil.
Eine Studie an der Yale-University zeigte, dass ältere Teilnehmer, die stereotype Sätze über Senioren lasen wie „Alte Menschen sind vergesslich“ sich langsamer aus dem Raum bewegten als eine Vergleichsgruppe, die diese Suggestionen nicht gelesen hatten.
Korte inspiriert zur Selbstreflexion
An solchen Stellen zeigt sich der Wert von Kortes Werk: Während unzählige „Erkenne dich Selbst“ Ratgeber zwar versprechen, einen Zugang zur Selbstreflexion der Leser zu geben, ohne diese Versprechen aber einzulösen, zwingt sein erst einmal nicht als Lebenshilfe angepriesenes Sachbuch zu genau solchen „Aha-Erlebnissen“.
Spätestens die von ihm beschriebene suggestive Wirkung der eigenen Vorurteile oder der Vorurteile anderer, inspiriert den Leser zum Mitdenken und setzt ihn in eine Beziehung zu den beschriebenen Problemen: Kennen wir nicht alle die als Kind empfangenen Botschaften wie „du bist technisch nicht begabt“, „aus dir wird nie etwas“, „du kannst das nicht“ und ihre Wirkung auf unsere Selbstwahrnehmung und unser daraus folgendes Denken und Handeln?
Wie groß ist die Zahl derjenigen, die wegen einer schlechten Schulnote im Teenageralter einen Studiengang nicht wählten, obwohl sie für das Fach brannten? Oder derjenigen, die einen Beruf wählten, mit dem sie unglücklich sind, weil sie immer wieder hörten, dass ihre wirklichen Interessen „brotlose Kunst“ seien?

Manche suchen sich bewusst die Bereiche, von denen ihnen suggeriert wurde, dafür ungeeignet zu sein und strampeln sich so langsam, aber sicher frei. Dann kommen sie wieder in die alten Gedächtnismuster, wenn die Personen, die die Vorurteile haben, ihnen diese erneut einreden. Wieder andere verlieren ihre Vorurteile auch über sich selbst durch neue Beziehungen, die die Erinnerungen neu zusammen setzen und Erlebnisse neu bewerten.
Zum Beispiel lernt ein Mann, dem seine Eltern suggerierten, er sei technisch unbegabt, eine Partnerin kennen, die die Vorurteile der Eltern nicht hat. Er renoviert mit ihr zusammen die gemeinsame Wohnung, und sie ist geschockt, als die Eltern in ihrer Gegenwart diese vertreten. Hier kann jetzt eine neue Rekonstruktion in der Kommunikation mit der Partnerin die alte Konstruktion ersetzen, zum Beispiel, indem der Partner Episoden erinnert, in denen er seine technischen Fähigkeiten bewies.
Andere aber haben nie die Gelegenheit, durch solche neuen Erfahrungen die Vorurteile über sich selbst oder andere zu reflektieren. Reflektieren bedeutet, sich zuerst einmal bewusst zu machen, dass es sich um eben solche handelt, so wie ein Problem nur zu lösen ist, wenn jemand weiß, dass es dieses Problem gibt.
Vorurteile einschränken
Jeder Mensch hat notwendig Vorurteile, und dies einzugestehen, ist laut Korte, der erste Schritt, sie einschränken zu können.
Es handele sich dabei um unbewusste, schnelle und übergeneralisierte Prozesse des impliziten Gedächtnisses. Eine Studie ergab, dass ein 10-minütiges Gespräch diese beeinflussen kann hin zu einem offeneren Weltbild. Thema waren Transsexuelle.
Bemerkenswert war, dass die Menschen, die ihre Vorurteile einschränkten, nicht mit einem Menschen aus dieser Minderheit gesprochen hatten. Der Kontakt mit Minderheiten allein könne sie hingegen nicht aufheben, sachliche Aufklärung und Information würden helfen.
Wir können, laut Korte, Vorurteile, also überzogene Verallgemeinerungen unseres Gedächtnisses, nicht vermeiden. Aber, so schreibt er „je mehr wir über die Welt wissen, umso differenzierter nehmen wir sie wahr und desto weniger ungerechtfertigte Vorurteile entwickeln wir.“
Zusätzlich müssten wir aber das eigene Denken, Handeln und Wahrnehmen reflektieren. Vorurteile ließen sich erkennen, benennen und bekämpfen.
Sucht
Was haben Suchterkrankungen mit dem Gedächtnis zu tun? Laut dem Experten sind sie von diesem nicht zu trennen, da es sich neurobiologisch um starke Gewohnheiten handle, über die ein Mensch die Kontrolle verloren habe.
Der Kontrollverlust zeige sich darin, dass die Belohnung ausbleibe, die bei minder verfestigten Gewohnheiten den Reiz darstelle. Das Belohnungssystem verhindere Abhängigkeiten.
Dies verschiebe sich bei einer Abhängigkeit. Hier ist der Impuls so stark, „dass die Gier nach dem Suchtmittel sich über die Routine verselbstständigt.“ Auf der zellulären Ebene fänden Süchte mit den gleichen Molekülen statt und an den gleichen Synapsen wie physiologische Lernprozesse. In bestimmten Hirnregionen funktioniere das Lernen bei Süchten zu gut, und das Vergessen werde fast unmöglich.
Wiesen Reize darauf hin, dass der nächste Drogenkonsum bevorstehe, werde Dopamin ausgeschüttet. Dieses suggeriere zugleich, dass die Droge dem Köper umgehend zugeführt werde, und dies führe zu einem unstillbaren Verlangen nach ihr. Ändere sich der Lebenskontext, stiege die Chance, von der Droge loszukommen, denn Sucht habe, ebenso wie andere Formen des Gedächtnisses, mit Reizen und Objekten zu tun, die den Ablauf in den Synapsen auslösten.
Auch die angelernte Sucht, übermäßig zu essen, habe mit dem Gedächtnis zu tun. So speichere das Gehirn das Essen bestimmter Nahrungsmittel als Belohnung, obwohl der Kalorienbedarf gedeckt sei. Wir nehmen zu. Exzessives Essen wird zu einer unbewussten Gewohnheit.
Schlechte Gewohnheiten überlisten
Wir können, Korte zufolge, Gewohnheiten, die uns schaden, überlisten. Zwar seien Gewohnheiten nicht unbedingt negativ; sie entlasteten das Arbeitsgedächtnis und ließen uns Muster erkennen, und selbst unter Stress die richtigen Handlungsabläufe durchführen. Das Problem sei, dass unser Gehirn nicht zwischen guten und schlechten Gewohnheiten unterscheide.
Dabei machten viele den Fehler zu denken, schlechte Gewohnheiten ließen sich mit guter Absicht ändern. Dies träfe aber nicht zu, wenn ein Verhalten automatisiert sei. Gewohnheiten entwickelten sich über die Dauer von circa einem Monat, und genau so lange dauerte es, sie wieder abzulegen.

Studien zeigen, dass ein Verhalten auch dann besteht, wenn die Betroffenen die Absicht haben, es zu ändern. Das gilt besonders für Suchtverhalten, aber nicht nur. Die persönlichen Ziele allein brechen nicht mit alten Gewohnheiten. Dafür bedarf es neuer Routinen und Gewohnheiten. In einer sozialen Gruppe und ohne äußeren Druck fiele es am leichtesten, Gewohnheiten zu ändern.
Die Willenskraft, um Gewohnheiten zu ändern, ließe sich auch durch Achtsamkeit stärken. Diese stärke die Kontrolle des Stirnlappens als Exekutive des Gehirns. Dazu sei es nötig, präsent, präzise und unvoreingenommen zu beobachten, was da ist, ohne sofort unreflektiert zu bewerten.
Kortes Fazit ist positiv: „Wenn man an Veränderung glaubt, wenn man sie sich zur Gewohnheit macht, wird sie auch real. Das ist die eigentliche Macht der Gewohnheit, die Einsicht, dass unsere Gewohnheiten nur das sind, was wir aus ihnen machen.“
Wer Gewohnheiten ändern wolle, müsse den Dreiklang aus Auslösereiz, Routine und Belohnung durchbrechen.
Der Speicher wächst mit seiner Fülle
Auch in erwachsenen Gehirnen können sich noch Neuronen bilden, erklärt der Experte. Im Gedächtnis seien diese neuen Neuronen womöglich die Erklärung dafür, dass Menschen, die lebenslang offen für Neues waren, auch im Alter noch besser lernen und sich erinnern könnten.
Die adulte Neurogenese sei verantwortlich für das Bilden von neuen Synapsen und die Verästelungen von Nervenzellen und auch dafür, dass neue Neuronen in die bestehenden Schaltsysteme eingebaut würden. Die neuen Nervenzellen würden sogar neuen Speicherplatz im Gehirn schaffen. Und sie würden durch das Lernen von neuem gebildet.
Das bedeutet: Wer viel und neues lernt, der schafft sich nicht nur mehr Wissen, sondern auch einen größeren Speicher im Gehirn, um neue Gedächtnisinhalte aufzunehmen.
Ein Traum wird wahr: Lernen im Schlaf
Auch der Traum gehöre zu den Bereichen unseres Gedächtnisses. Träume spiegelten aktuelle Gefühlszustände, wobei die diesen entsprechenden Geschichten oft erst beim Aufwachen entstünden.
Schlafmangel führe unter anderem zu Gedächtnisverlust. Der Autor meint, Schlaf diene dazu, das innere Gleichgewicht unseres Gedächtnisses herzustellen. Im Schlaf gelänge es, tagsüber Gelerntes zu wiederholen und Lerninhalte innerhalb eines Kontextes assoziativ zu verbinden.
In REM-Phasen werde das Wahrnehmungslernen verarbeitet, in den Tiefschlafphasen autobiographische Erlebnisse sowie Faktenwissen.
Auch das motorische Gedächtnis arbeite im Schlaf. Es optimiere nachts Nervenzellen für eine bestimmte Aufgabe und würde immer wieder genau die Hirnbereiche durchlaufen, die tagsüber aktiv waren.
Korte zufolge belegen Studien, dass Musiker Stücke, die sie tagsüber lernten nach ausreichend Schlaf am nächsten Tag besser beherrschten. Dies gälte besonders für Passagen, in denen sie zuvor Fehler gemacht hätten. Offensichtlich wiederholte das Gehirn nicht nur das Gelernte, sondern glich auch die Fehler aus.
Darüber hinaus strukturiere das Gehirn im Schlaf die Informationsverarbeitung zwischen den Nervenzellen. Wir lernen im Schlaf durch Wiederholung das, was wir tagsüber lernten. Wenn wir zuwenig oder schlecht schlafen, lernen wir unzureichend – wenn wir keinen Schlaf bekommen, kann das zu Amnesie führen. Wenn wir tagsüber an Problemen feilen, bereitet uns das Schlafgedächtnis auf die Lösung vor.
Luzide Träume
Er geht weiter auf das mit Mythen behaftete Thema „luzide Träume“ ein. Um unsere Schlafphase für aktives Lernen zu aktivieren, gelte: Wer regelmäßig zur gleichen Zeit zu Bett geht und aufsteht, kann umso besser im Schlaf lernen, weil er besser ein- und durchschläft.

Der Unterschied zwischen Klarträumen und normal träumen liege darin, dass beim luziden Träumen der Stirnlappen aktiv bleibe. Der Experte sieht ein Potenzial, Klarträume zum Lernen zu nutzen oder um Ängste zu besiegen.
In der ersten Schlafphase sortiere das Gehirn die Erinnerungen des Tages in wichtige und unwichtige, um die zweite Phase Geschehnissen aus der Zeit davor zu widmen.
Laut Korte läuft im Schlaf die Gedächtnisarbeit ab, allerdings ohne den inneren Erzähler unseres bewussten Denkens, „Träume wären somit die kleinen Inseln der Erinnerung an die Vorgänge, die in der Nacht in unseren Köpfen abgelaufen sind – stark verfremdet und stark verkürzt.“ Erst beim Aufwachen würden wir diese Fragmente wieder zu einem Narrativ verbinden.
Tricks und Training
Am Ende gibt er dem Leser praktische Tipps mit, um das Gedächtnis zu trainieren. Dabei gilt: Von nichts kommt nichts. Korte schreibt: „Wir erinnern uns also nur an das, was wir kodiert haben. Und was wir kodieren, hängt davon ab, was wir an Erfahrungen gesammelt haben, welche Kenntnisse wir haben und welche Bedürfnisse.“
Zwischen Lernblöcken sei Ablenkung und Entspannung notwendig. Das Gehirn brauche den Perspektivwechsel, um ein Problem zu lösen. Es werte Unterbrechungen als unerledigte Aufgaben. Diese aber blieben länger im Gedächtnis als erledigte Aufgaben.
Unterbrechungen würden es aktivieren, denn unterbrochene Projekte würden an der Spitze der mentalen Prioritätenliste stehen.
Die entspannteste Form des nachhaltigen Lernens sei Schlafen.
Der Autor widerspricht den klassischen Lernratgebern, nach denen man immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort lernen solle. Das Lernen an verschiedenen Orten, Zeiten und mit verschiedenen Stimmungen erhöhe jedoch die assoziative Gedächtnisleistung. Je häufiger wir an verschiedenen Orten lernten, umso besser könnten wir uns auch an verschiedenen Orten erinnern.
Wir könnten aber auch Lernstoff neu strukturieren und dadurch die Assoziationswege verstärken. Veränderte Lerngewohnheiten bereicherten die Fähigkeit, die wir erlernen wollten. Je mehr Abwechslung, je mehr Mischung der Lernmethoden, desto besser würden wir etwas lernen und im Gedächtnis abrufen. Mechanisches Wiederholen diene hingegen nur dem Kurzzeitgedächtnis.
Nachhaltiges Lernen bedeute kürzere Lernphasen und größere Abstände zwischen den Wiederholungen. Wer Lerninhalte in kleine Portionen aufteile und in kürzeren Intervallen lerne, könne die Menge, an die er sich erinnere, verdoppeln. Besonders wirksam sei diese Methode, um etwas völlig Neues zu lernen. Die Intervalle und Pausen zu bestimmen, um effektiv zu lernen, bedeute vor allem: Planung.
Der Lerntyp hätte keinen Einfluss auf den Lernerfolg. Effektives Lernen bedeute vielmehr, verschiedene sensorische Systeme anzusprechen. Der Lernende müsste aktiv beteiligt sein. Das Gelernte für andere zu formulieren, erhöhe den Erfolg.
Erinnerungen würden umso besser, je mehr man sich beim Lernen anstrengen müsse. Das widerspräche dem Lernen nach seinem speziellen Lerntyp: Wenn wir Informationen nur über den bevorzugten Sinneskanal zu uns nähmen, bliebe in der Erinnerung kaum etwas hängen.
Prüfungssituationen zu Beginn erhöhten die Gedächtnisleistung um 30 %. Tests seien also ebenso Lernmethode wie Lernbewertung: „Wenn wir Gedächtnisinhalte in einer Testsituation abrufen, speichern wir diese Inhalte im Gedächtnis erneut – aber mit anderen verwandten Fakten.“
Auch Ernährung spiele eine Rolle, besonders Übergewicht schade dem Gedächtnis, und da vor allem die Fettdepots im Bauchbereich. Ausdauertraining vermehre die Zahl neuer Nervenzellen im Hippocampus. Für dieses sind geringe Mengen an Alkohol und Kaffee besser als gar keine, da Koffein und Alkohol in niedrigen Dosen über gesteigerte Durchblutung kognitive Ressourcen im Gehirn erhalten würden.
Wir sollten uns für das motvieren, was wir lernen wollen, fokussiert und konzentriert lernen, anderen erzählen, was wir wissen, um es besser zu begreifen und zu behalten. Wir können, so Korte, unserem Gedächtnis helfen, indem wir uns bewegen, aus Gewohnheit mit Gewohnheiten brechen, beim trainieren ein Ziel vor Augen haben, unsere möglichen Kompetenzen regelmäßig überprüfen.
Fazit
Martin Korte ist Professor für Neurobiologie und schöpft aus einem umfangreichen Wissen zum menschlichen Gehirn und Gedächtnis. Zugleich kann er diese komplexen Zusammenhänge plastisch vermitteln – auch für fachliche Laien.
Unzählige Anleitungen kursieren auf dem Markt, die „Gehirntraining“ anbieten, manche mit einigen nützlichen Tipps für Gedächtnisübungen, gesundes Essen oder mäßigen Sport – andere aufgepumpt mit esoterischem Nonsens, „kosmischen Eingebungen“ und irrationalen Heilsversprechen.
Korte spielt in einer gänzlich anderen Liga, und seine Schlüsse für das praktische Leben, um die Leistungen des Gedächtnisses zu verbessern, unterscheiden sich wohltuend von der „Gehirnwäsche“ dieses antiaufklärerischen Psychomarktes.
Er zeigt neurobiologisch genau, was im Gehirn passiert, während wir lernen, Vorurteile entwickeln, an Süchten leiden – wenn wir schlafen und träumen, wir uns erinnern. Damit wird deutlich, wo wir sinnvoll ansetzen können, wenn wir unser Erinnerungsvermögen verbessern und geistig fit werden wollen. Er ermöglicht es dem Leser, zu verstehen, was in dessen Kopf passiert. Und erst dieses Verstehen ermöglicht Verbessern.
Dabei stellt er neue Erkenntnisse weit verbreiteten Mythen entgegen: Das Gedächtnis ist keine Chronik, und wir sollten Menschen nicht glauben, die behaupten, sich objektiv erinnern zu können; das Gehirn ist nicht unveränderbar, sondern verändert sich ein Leben lang; die Gedächtnisfähigkeit muss im Alter nicht abnehmen, sie kann sich bei lernbegierigen Menschen sogar steigern; wir werden nicht primär, was in unseren Genen steckt, sondern, was wir lernen und erinnern. Träume sind weder Schäume noch höhere Weisheiten, sondern Fragmente unserer nächtlichen Hirnarbeit.
Das Buch ist zudem spannend geschrieben und eine echte Hilfe, um sich selbst zu erkennen. Sehr zu empfehlen. (Dr. Utz Anhalt)
Autoren- und Quelleninformationen
Dieser Text entspricht den Vorgaben der ärztlichen Fachliteratur, medizinischen Leitlinien sowie aktuellen Studien und wurde von Medizinern und Medizinerinnen geprüft.
- Martin Korte: Wir sind Gedächtnis. Wie unsere Erinnerungen bestimmen, wer wir sind, Deutsche Verlags-Anstalt, München 2017
Wichtiger Hinweis:
Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen.









