Buchrezension: Still / Die Kraft der Introvertierten
Susan Cain arbeitet als Trainerin für Verhandlungstechniken in den USA. So ist sie ständig mit einer Gesellschaft konfrontiert, in der extrovertierte Menschen als Maßstab gelten und Introvertierte „an ihren Schwächen arbeiten“ müssen. „Ihre Eigenschaften wie Ernsthaftigkeit, Sensibilität und Scheu gelten heute als Krankheitssymptome, denn als Qualitäten,“ so der Eingangstext in dem Buch „Still / Die Kraft der Introvertierten“.
Cain hält dies für einen großen Fehler. Zum einen diskriminiere es die Introvertierten, zum anderen sei deren Potenzial sehr wertvoll. So zählten zu ihren Stärken Sorgfalt, Rücksicht und die Fähigkeit, zuzuhören.
Inhaltsverzeichnis
Extrovertierte als Ideal
Extrovertierte werden Cain zufolge in den USA systematisch vorgezogen. So habe sich die renommierte Harvard Universität auf „gesunde extrovertierte junge Männer“ konzentriert. Der ideale Angestellte sei kein tiefer Denker, sondern ein Extrovertierter mit Vertretermentalität. Wissenschaftler sollten nicht nur gut in ihrem Fach sein, sondern auch bei der Vermarktung helfen, kumpelhaft auftreten und verkaufen.

Amerika – das Land der Tat
In Amerika steht laut Cain Extroversion weit mehr im Vordergrund als zum Beispiel in Asien oder Afrika. Eine Erklärung dafür sei die Geschichte der USA als Einwanderungsland. Menschen, die in die Welt hinauszogen, seien extrovertierter gewesen als Sesshafte. So habe jede Einwanderungswelle zu einer neuen Ansammlung von Extrovertierten geführt, die proportional jeweils größer gewesen sei als in ihrem Herkunftsland.
Bereits die Griechen und Römer hätten Extrovertierte geschätzt, wie die Bedeutung der Rhetorik bei den Griechen belege. In Amerika habe sogar das Christentum mit seinen Erlöserkulten auf das Schauspieltalent der Prediger zurückgegriffen.
Die frühen US-Amerikaner hätten Tatkraft sogar so verherrlicht, dass sie Intellektualität verachteten und „geistiges Leben mit der trägen und uneffektiven Aristokratie assoziierten, die sie hinter sich gelasssen hatten.“ Nur sehr wenige amerikanische Präsidentschaftskandidaten seien introvertiert gewesen.
Introversion als psychische Krankheit
Heute seien Status, Einkommen und Selbstbewusstsein eng damit verknüpft, sich gut zu verkaufen und nie Angst zu zeigen. Die Messlatte furchtloser Selbstdarstellung werde immer höher, so dass inzwischen jeder fünfte Amerikaner als pathologisch schüchtern gelte. Wie Cain berichtet, wird die Angst, mit anderen zu sprechen, von der Psychologie in den USA nicht etwa als Nachteil, sondern sogar als Krankheit gewertet.
Einladung zu Skrupellosigkeit
Nach wie vor gelte der Vorsatz: „Alles reden ist verkaufen, alles verkaufen ist reden“. Dies gehe in fragwürdige Ziele über. „Sollen wir so geschickt bei der Selbstdarstellung werden, dass wir uns verstellen können, ohne dass es jemand merkt?“ (57). Das Ideal der Extroversion geht über in skrupellose Bestrebungen, so Cain.
Der Mythos der charismatischen Führung
Verkaufsmentalität wurde in den USA zur Tugend, schreibt Cain und erörtert, wie es dazu kam: So habe am Anfang des Persönlichkeitskults gestanden, dass eine extrovertierte Persönlichkeit zu entwickeln, hilft, andere in der Konkurrenz zu überflügeln. Heute würden Amerikaner glauben, extrovertiert zu sein, mache sie zu besseren Menschen.

Auf dem Campus der Harvard Business School bummele, schlendere oder trödle niemand. Alle eilten und begrüßten sich lebhaft, niemand habe größeres Übergewicht, schlechte Haut oder unpassende Accessoires. Ein Student habe zu ihr gesagt: „Diese Hochschule basiert auf Extraversion. Davon hängen die Noten und der soziale Status ab.“ (73)
Die Hochschule stelle Standards auf wie: „Auch wenn du etwas nur zu 55 Prozent glaubst, sprich, als glaubtest du hundertprozentig daran“ oder „Es ist besser aufzustehen und etwas zu sagen, als dich nie zu äußern.“ (78) Geselligkeit unter Studierenden sei wie Extremsport. Sich kein großes soziales Netzwerk zu schaffen sei, wie seine Zeit zu verplempern.
Falsche Vorstellungen von Kreativität
Selbst Firmen, die Designer und Künstler beschäftigten, suchten Extrovertierte und definierten kreativ als „umgänglich, witzig und gut drauf sein…“ (81). Ohne, dass Cain es erwähnt, sind dies Fähigkeiten, die mit der Qualität eines Designers oder Künstlers nicht das geringste zu tun haben. Es sei kein Zufall, dass der Werbeslogan von Nike „Just do it“ so erfolgreich geworden ist.
Die Harvard Business School selbst habe jedoch ein Rollenspiel entworfen, in dem klar geworden sei, dass das schnelle und selbstbewusste Führen nicht ganz richtig ist. Sie habe ein Spiel „Überleben in der Subpolaregion“ gestartet, um Gruppensynergie zu lehren, also erfolgreiches Zusammenarbeiten im Team. Just hier zeigte sich, dass genau die Gruppen scheitern könnten, die Selbstbehauptung zu hoch bewerteten. So hätten sich die lautstärksten Teilnehmenden mit ihren Ideen durchgesetzt, weniger lautstarke seien abgeschmettert worden (obwohl die Ideen möglicherweise besser waren).
Konstruktive Paranoia
Dieses von Cain beschriebene Spiel kann man sich lebhaft in einer real existierenden Situation vorstellen. Da führen undurchdachte, aber schnelle Vorschläge rasch zum Tod aller. Denn diese haben es in sich, dass sie nicht sorgfältig alle Aspekte durchgehen. Was Cain nicht erwähnt, aber der Evolutionsbiologe Jared Diamond, ist die bei indigenen Völkern verbreitete konstruktive Paranoia. Sie verhalten sich also übervorsichtig in Situationen, in denen vermeintlich keine unmittelbare Gefahr droht. So erforschen die Menschen in Papua-Neuguinea systematisch die Bäume ringsum, bevor sie ein Lager aufschlagen. So gehen sie sicher, dass sie nicht von umstürzenden Bäumen erschlagen werden, wenn sie darunter übernachten. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit hierfür denkbar gering ist, erhöht sie sich immer mehr, je öfter der Mensch unter den Bäumen schläft.

Ungenutztes Potenzial
Cain hält es für einen Grund, sich Sorgen zu machen, wenn stillere Teilnehmer weniger in Lösungen einbezogen werden. Menschen, die mehr reden, würden als intelligenter, besser aussehend und sympathischer beurteilt. Wer schnell rede, gelte als kompetenter und attraktiver als langsame Redner. Dabei hätten Studien ergeben, dass es keinen Zusammenhang zwischen schnellem Reden und Klugheit gibt.
Was machen introvertierte Führungskräfte besser?
Extrovertierte Führungskräfte seien besser, wenn die Angestellten zur Passivität neigen, introvertierte, wenn die Angestellten Eigeninitiative zeigen. Introvertierte hörten sich die Vorschläge ihrer Mitarbeiter an und setzten sie um. Sie setzten einen positiven Kreislauf der Eigeninitiative in Gang. Hingegen könne es bei Extrovertierte schnell passieren, dass gute Ideen anderer nicht zur Kenntnis genommen werden. Während die Literatur Ratschläge gebe, wie Introvertierte ihre rhetorischen Fähigkeiten verbessern sollten, sollten Extrovertierte lernen, sich zu setzen, damit andere aufstehen könnten.
Überdosis an kreativer Zusammenarbeit
Laut Cain strebt das heutige Modell des Teamworks nach einer Überdosis kreativer Zusammenarbeit und verweise auf Statements, nach denen Erfinder, Ingenieure und Künstler meist scheue Kopfmenschen seien. Sie würden am besten allein arbeiten, nicht in einem Gremium und auch nicht in einem Team.
Zumindest, so verweist sie auf Studien, seien viele Introvertierte sehr kreativ. Das sei auch kein Zufall, denn Alleinsein sei für Kreativität und Produktivität oft entscheidend. Introversion verhindere die Zerstreuung auf sexuelle und soziale Angelegenheiten, die nichts mit der Arbeit zu tun haben.
Autonomie statt Gruppenzwang
Die Autorin schlägt vor, Kinder zu lehren, unabhängig zu arbeiten, und Angestellten viel Privatsphäre und Autonomie zu geben. Das neue Gruppendenken stelle hingegen Teamarbeit über alles. Es beharre darauf, dass Kreativität und intellektuelle Leistung eine Sache der Gemeinschaft sind. Unternehmen würden ihre Arbeitskräfte zunehmend in Teams organisieren, und 91 Prozent aller Topmanager glauben Cain zufolge, dass Teams der Schlüssel zum Erfolg sind.
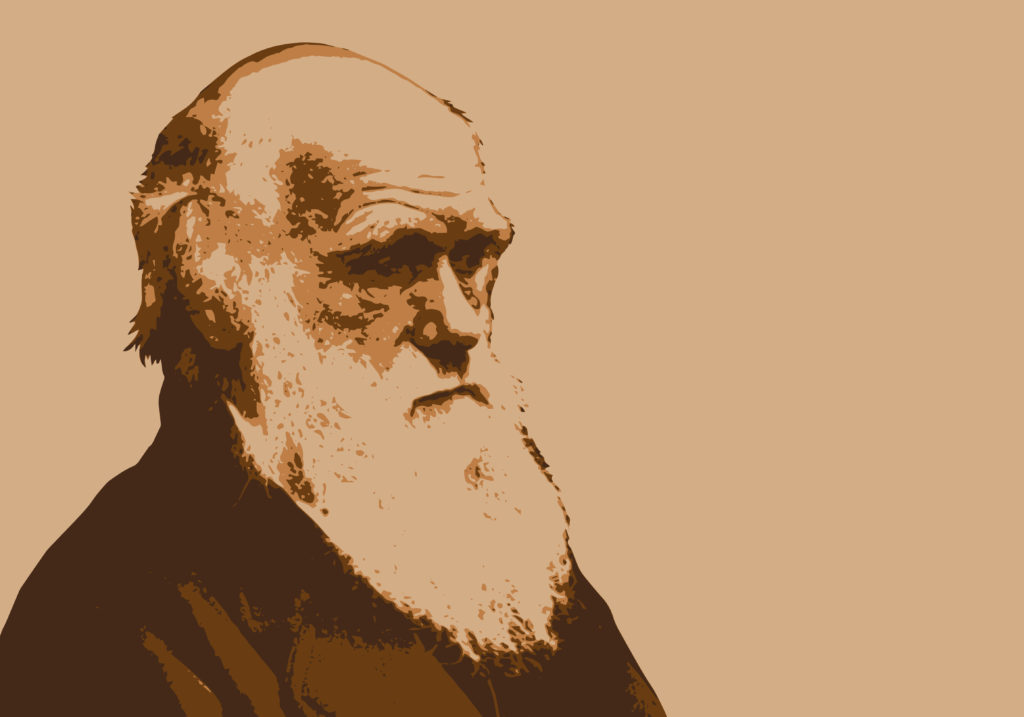
Während aber manche Menschen das Bedürfnis haben, sich harmonisch in eine Gruppe einzugliedern, möchten andere unabhängig bleiben. Führung und Führung sei auch nicht gleich. Cain verweist auf introvertierte Geistesgrößen wie Charles Darwin, der lange Jahre seines Lebens in Einsamkeit verbrachte. Kurz gesagt: Extrovertierte erreichten oft eine soziale Führungsrolle, Introvertierte eher eine Führungsrolle auf theoretischem oder ästhetischem Gebiet.
Alleinsein als Motor
Gezieltes Üben erfordere hohe Konzentration, dabei könnten andere Menschen ablenken. Hohe Motivation müsse man aus sich selbst schöpfen. Allein arbeiten bedeute, an dem zu arbeiten, was für den Übenden persönlich am schwersten sei. Wer sich verbessern wolle, müsse direkt den herausfordernden Teil angehen. In einer Lerngruppe werde dieser Schritt von anderen übernommen. Zu kontaktfreudige Teenager kultivierten oft nicht ihre Talente, da sie sich vor Einsamkeit fürchteten. Charles Darwin habe zum Beispiel bereits als Kind lange, einsame Spaziergänge in der Natur unternommen.
In einer Studie haben die besten Programmierer in Firmen mit einem Maximum an Privatsphäre, persönlichem Raum und Kontrolle über ihre physische Umgebung gearbeitet, berichtet Cain. Großraumbüros minderten hingegen die Produktivität und verschlechterten das Gedächtnis. Menschen würden besser nach einem ruhigen Waldspaziergang lernen als nach dem Gang durch eine laute Stadt. Eines der größten Hindernisse für Produktivität bestehe darin, unterbrochen zu werden. Multitasking habe sich als Mythos erwiesen. In Wirklichkeit würden die Betroffenen nicht mehrere Aufgaben zugleich lösen, sondern zwischen ihnen hin- und herspringen, was die Produktivität senke.
Große Gruppen lähmen die Leistung
Persönlicher Freiraum sei ebenso unabdingbar für Kreativität wie Freiheit von Gruppendruck. Brainstorming in der Gruppe funktioniere nicht. Mit steigender Gruppengröße nehme die Leistung ab. Dennoch sei Brainstorming in Gruppen populär wie eh und je. Der Grund liege nicht in der belegbar schlechten Leistung, sondern darin, dass sich Menschen sozial eingebunden fühlen. Der Nutzen sei also sozialer Zusammenhalt, nicht Kreativität.
Brainstorming in der Gruppe versage aus drei Gründen, die sich auch nicht aufheben lassen: Erstens würden sich die Einzelnen in einer Gruppe zurücklehnen, zweitens könne nur jeweils einer eine Idee aussprechen, was zu Lasten der Produktivität der anderen gehe, und drittens gebe es die Bewertungsangst, vor Gleichrangigen dumm da zu stehen.

Fazit
Cain gibt wissenschaftlich abgesicherte und mit Praxis angereicherte Belege dafür, Introvertierte stärker als bisher introvertiert bleiben zu lassen und ihnen die Privatsphäre zu geben, in der sie besser arbeiten als in der Gruppe. Deutlich wird ihre intensive Erfahrung als Verhandlungstrainerin, die sie Fehlurteile über Kreativität einerseits und Selbstdarstellung andererseits erkennen lässt. In diesem Fokus auf Praxis liegt jedoch auch die Schwäche des Buches. Sie reißt die Leserinnen und Leser unmittelbar in das Geschehen hinein, ohne psychologisch zu klären, was extrovertiert und introvertiert überhaupt bedeutet, beziehungsweise was derart strukturierte Charaktere auszeichnet.
Das lässt sich zwar irgendwie zwischen den Zeilen erkennen, aber auch nur da. Deshalb ist es sinnvoll, zuvor oder parallel Einführungen in die Unterschiede von Persönlichkeiten zu lesen. Außerdem liegt ihr Fokus der Verhältnisse in den USA, was es für die hiesige Leserschaft vielleicht nicht jederzeit Nachvollziehbar macht. So ist Deutschland mit dem Nimbus der „Dichter und Denker“ traditionell ein Land, in dem einsame Denker, die Stille in der Natur und die Innerlichkeit der Romantik sogar Ideale waren und diesbezüglich ein Gegenpol zu dem „Just do it“ der USA besteht.
Für die Lesenden hierzulande wäre es interessant, zu vergleichen, wie sich die von Cain beschriebenen Denkmuster auch in Deutschland eingeschlichen haben und ob sie im Kontrast zu der so oft zitierten „deutschen Innerlichkeit“ stehen. Nichtsdestotrotz lohnt sich die Lektüre allemal, besonders, weil Cain am Ende wertvolle praktische Tipps für Eltern gibt, wie sich introvertierte Kinder am besten fördern lassen. Außerdem räumt sie mit dem Märchen auf, dass sich jede/r in jeder Situation bestmöglich verkaufen muss – ganz egal, ob dies seinem oder ihrem Charakter entspricht. (Dr. Utz Anhalt)
Quelle
Susan Cain: Still. Die Kraft der Introvertierten. Goldmann 2018. ISBN: 978-3-442-15764-8
Autoren- und Quelleninformationen
Wichtiger Hinweis:
Dieser Artikel enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen.









